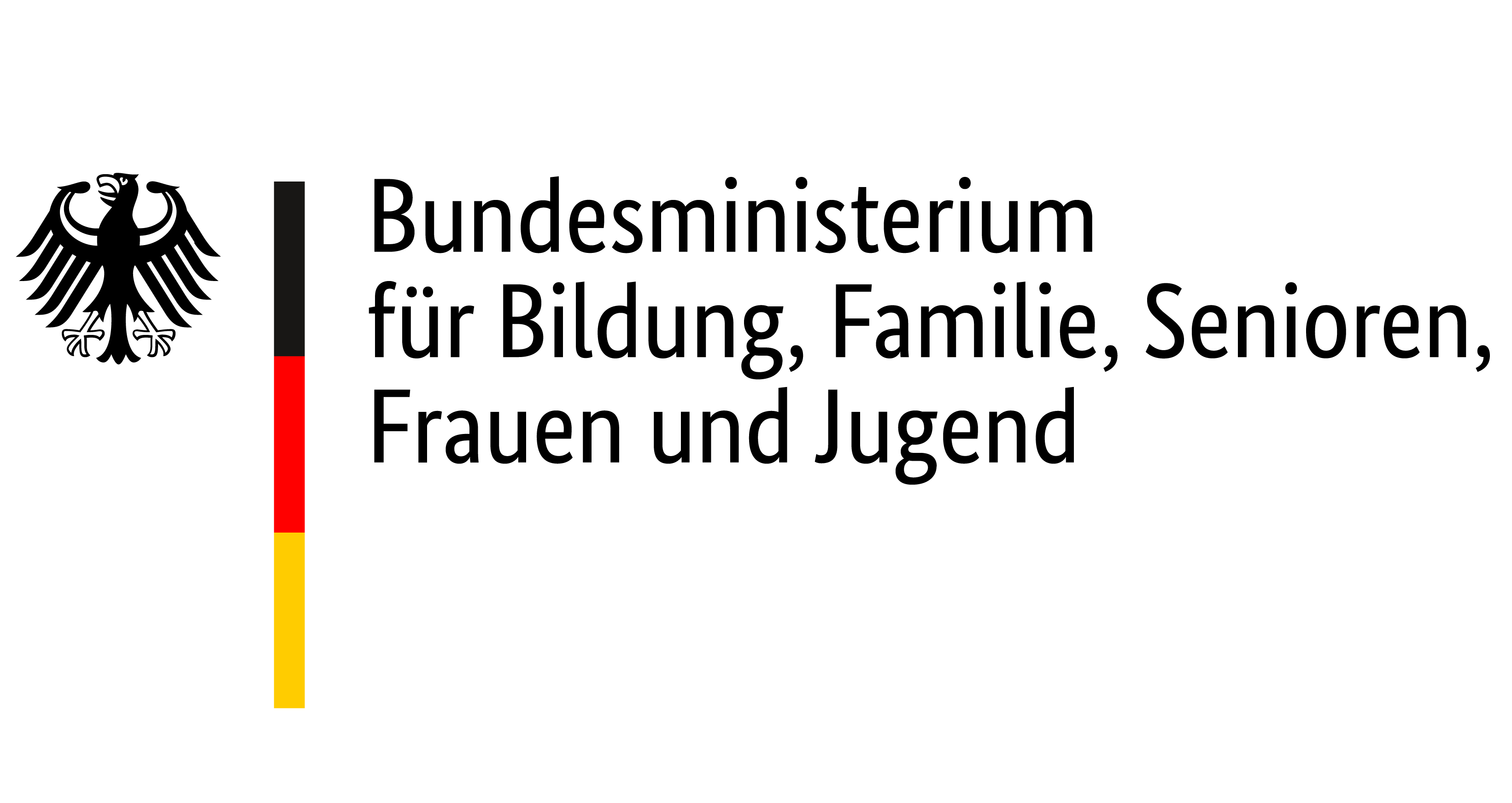Queer Outing
„Und wie haben deine Eltern reagiert?“
Die Frage Nach dem Coming-Out
Wer kennt sie nicht, die klassischen Coming Out Geschichten von queeren Jugendlichen, die gerne mal in TV-Reportagen gezeigt werden. Eines der zentralen Elemente: Das Coming Out gegenüber den Eltern. Der schicksalshafte Moment, in dem die Person verkündet: „Mama, Papa, ich bin bisexuell / lesbisch / schwul / passendes bitte einfügen“.
Doch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Dinge auch ganz anders laufen können und sich nicht die Erfahrungen aller queeren Menschen in den gleich klingenden Geschichten widerspiegeln.
Aber wie dann mit Fragen zur Familie umgehen? – Das habe ich auch noch nicht herausgefunden, doch ich teile gerne meine Geschichte, denn es ist mir wichtig zu verdeutlichen, warum sich das Stellen solcher und ähnlicher Fragen für betroffene Personen unangenehm anfühlen kann.
Ich habe mir im Laufe der Zeit ein eher nicht so heteronormatives Umfeld geschaffen, weshalb mir Fragen zu meinem Coming Out oder der Art und Weise wie ich denn nun Sex habe, gewöhnlich erspart bleiben. Nichtsdestotrotz kommt es vor, dass ich meine Homebase verlasse und dann kann es natürlich passieren, dass mir die typischen Fragen begegnen. Eine, die ich besonders anstrengend finde, ist: „Und wie haben deine Eltern reagiert?“ Ich komme dann in die unangenehme Situation, nicht lügen und nichts beschönigen und gleichzeitig mein Recht auf Privatsphäre in Anspruch nehmen zu wollen. Denn auch wenn ich mich für nichts schäme und durchaus offen mit jenem Teil meiner Biografie umgehe, bin ich der Meinung, dass Leute nicht das Recht haben, sofort alles über mich zu erfahren. Doch wenn ich mit meinen 18, fast 19 Jahren erzähle, dass ich den Kontakt zu meiner Mutter vor zwei Jahren abgebrochen habe, hat mein Gegenüber unweigerlich weitere Fragen parat. Manchmal wähle ich eine dritte Option und erkläre der Person, warum es ziemlich unreflektiert ist, mir diese Frage zu stellen. Das klappt mal mehr mal weniger gut.
Aber genug von dem Wie und hin zu dem Warum: Ich kann auf jene Frage, wenn ich sie denn ehrlich beantworten will, nicht mit einem „gut“ reagieren, weil meine Hintergrundgeschichte viel komplexer ist. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, die alleinerziehend war. Zu meinem Vater hatte ich schon jahrelang keinen Kontakt mehr. Zunächst einmal hatte ich nie dieses klassische Gespräch mit meiner Mutter, weil es zwischen uns nicht wirklich eine Kommunikationsgrundlage gab. Vielmehr war es so, dass wir uns gegenseitig anschwiegen und ich sogar versuchte, Small-Talk mit ihr zu vermeiden, da Gespräche mit ihr oft eine unangenehme Wendung nahmen. Dass wir politisch gegeneinander knallten, machte die Sache nicht einfacher. Sie war rechts-konservativ und jedes in ihren Augen abnormale Verhalten ihrer Kinder stellte eine Provokation und ein Herausfordern ihrer Autorität als Mutter dar. Die Situation Zuhause war für mich nicht mehr auszuhalten und so beschloss ich, den Kontakt zu meiner Mutter und meinen Großeltern mütterlicherseits abzubrechen.
Ich war 17 als ich meine Sachen packte und auszog. Meine Mutter habe ich damals vor vollendete Tatsachen gestellt und wie sie sich in dem darauffolgenden Jahr verhielt (wir standen über das Jugendamt notgedrungen in Verbindung), bekräftigte mich darin, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Wenn du minderjährig bist, brauchst du für alles Mögliche die Zustimmung deiner/deines Erziehungsberechtigten. Einen Mietvertrag schließen oder ein Konto eröffnen, Anträge auf Wohngeld usw. stellen? – unmöglich ohne die Zustimmung meiner Mutter. Um ausziehen zu können ohne obdachlos zu werden oder ohne Geld (ich ging damals noch zu Schule) bei Freund*innen unterzukommen, die selber nicht besonders reich waren, musste ich also über das Jugendamt gehen. Ich kam in eine betreute Wohngruppe für Jugendliche, eine Einrichtung der Stationären Jugendhilfe, die von einem freien Träger betrieben wurde und wohnte dort für ein Jahr, bis ich 18 wurde und in eine eigene Wohnung zog. Ich lebte mit zwei anderen Jugendlichen meines Alters in einer WG, einer eigenen kleinen Wohnung ohne Dauerbetreuung und da wir die Älteren waren, hatten wir viele Freiheiten, mussten selbstständig für uns einkaufen, kochen und den Haushalt schmeißen. Wenn ich nicht in dieser Einheit, sondern bei den Jüngeren im Alter von 13 bis 16 untergebracht worden wäre – mit Dauerbetreuung, strengeren Ausgangszeiten, festen Essenszeiten – wäre das Jahr für mich weniger angenehm geworden.
In der WG war ich als Trans*Männlichkeit geoutet. Unfreiwillig. Als ich mein Zimmer bezog, folgten mir meine Mitbewohner*innen, um nachzuhaken. Sie waren sichtlich uninformiert, denn außer vagen Aussagen war ihnen nichts vermittelt worden. Eine der Betreuerinnen hatte geplaudert, ohne dies mit mir abzusprechen. In jenem Betreuten-Wohnen-Kontext bedeutete Out-Sein, von Betreuer*innen umgeben zu sein, die bzgl. trans* überhaupt nicht kompetent waren aber auch nicht auf die Idee kamen, mich bei bestimmten Sachen zu fragen. Es beinhaltete, dass eine Betreuerin mich und meine Mitbewohnerin dermaßen oft mit „Hi Mädels!“ begrüßte, wenn sie zu uns in die Wohnung kam, um nach dem Rechten zu sehen, dass ich davon überzeugt bin, sie hat es mit Absicht gemacht. Nicht zu vergessen das eine Mal, als ich bei einer Freund*in übernachtete, mich bei einer Betreuerin abmeldete und sie mich fragte, was besagte Freund*in denn jetzt untenrum hat. Meine verbale Abwehrreaktion darauf wurde mit einem Grinsen übergangen; um nur zwei Beispiele aus meinem Alltag zu nennen.
Glücklicherweise wohnte ich nicht drüben bei den Jüngeren. Mit meinen Mitbewohner*innen kam ich gut klar und der Kontakt zu Betreuenden beschränkte sich auf ein Minimum. Ich nutze die neugewonnenen Freiheiten und im Vergleich zu dem, wie ich vorher bei meiner Mutter gelebt hatte, war die WG eine Verbesserung.
Zu meinem Vater und meiner Familie väterlicherseits habe ich mittlerweile wieder Kontakt. Das Verhältnis ist gut, auch wenn wir uns nicht oft sehen. Mit meinem Trans*Sein hatte er keinerlei Probleme und er hat auch sonst gut reagiert.
Happy End.
Meine Geschichte lässt sich nicht in zwei oder drei Sätze pressen. Genauso wenig kann ich auf „Und wie haben deine Eltern reagiert?“ in einem Satz antworten, ohne zu verhindern, dass bei der*dem Fragesteller*in Bilder im Kopf aufgehen, die nichts mit meiner Lebensrealität zu tun haben, sondern nur deren Vorstellungen vom Leben queerer Jugendlicher bedienen.
Ich persönlich wünsche mir daher nicht nur eine größere Bandbreite an Coming Out Geschichten in den Medien, sondern vor allem einen reflektierteren Umgang mit den Antworten, die heteronormative Menschen beim Stellen solcher Fragen erwarten.
Von Iwan